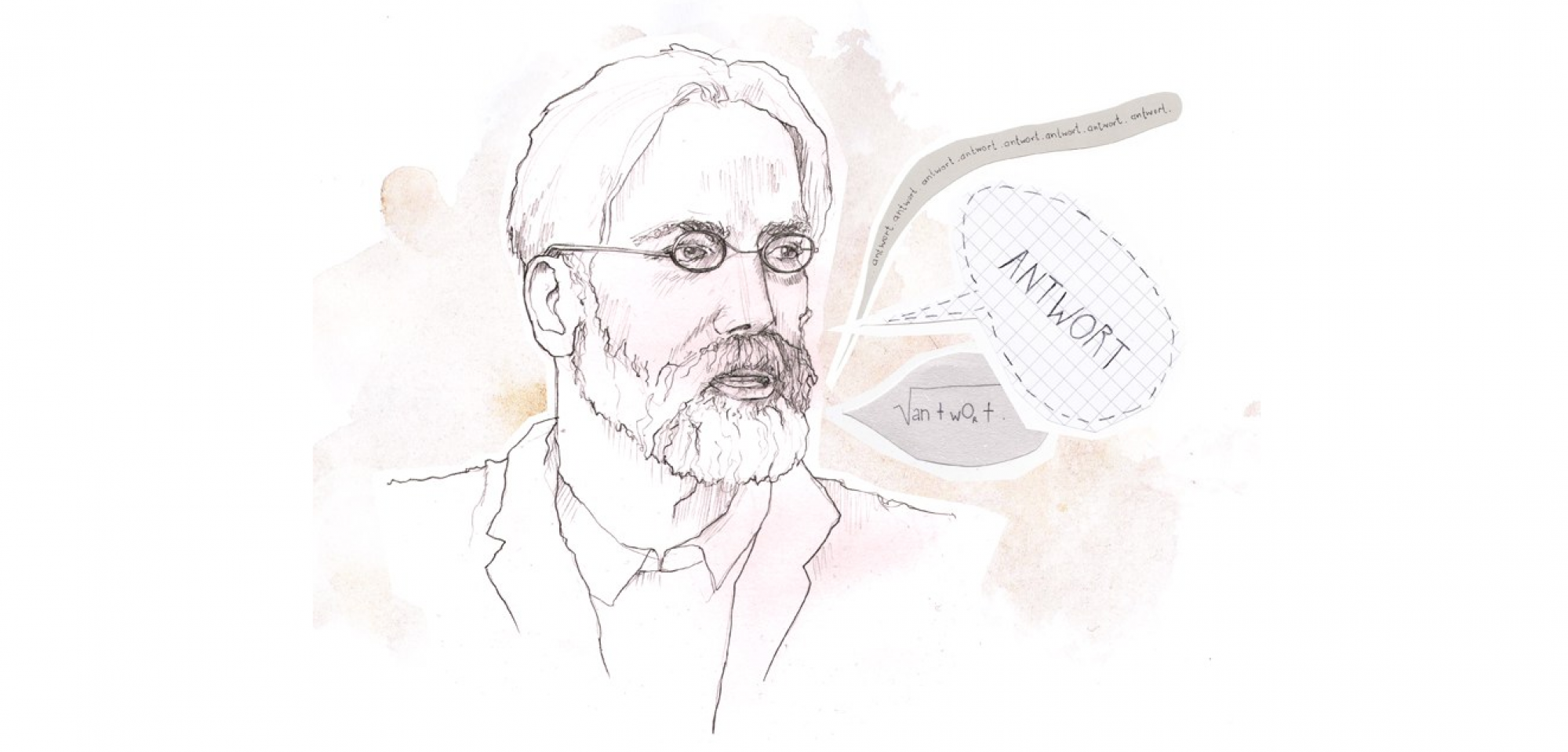StimmtHaltNicht – So, wie es die Solothurner Zeitung tut, lässt sich die jüngste Veröffentlichung der amerikanischen Forscherin Madhura Ingalhalikar sicher nicht zusammenfassen. Denn ums Einparken ging es in der Studie bestenfalls indirekt.
Die eigentliche Frage war: Sind die Gehirne von Männern und Frauen unterschiedlich verdrahtet? Das Team um Ingahalikar sagt: Ja, zwischen den Geschlechtern bestehen fundamentale Differenzen.
Allerdings haben einige Fachleute Bedenken an dieser in den Proceedings of the National Academy of Sciences veröffentlichten Arbeit. Nach einer kritischen Einordnung haben wir zumindest in deutschsprachigen Medien vergeblich gesucht. FAZ, Spiegel Online und viele andere geben nur die Einschätzungen der Studienautoren wieder. Wir haben deshalb einige Kritikpunkte zusammengetragen.
Zunächt jedoch ein paar Worte dazu, was die Wissenschaftler aus Philadelphia überhaupt gemacht haben. Sie untersuchten 949 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mithilfe der sogenannten Diffusions-Tensor-Bildgebung. Der Kniff dabei: Anhand der Bewegung von Wassermolekülen konnten sie Erkenntnisse über den Verlauf von Nervenfasern gewinnen. Ingalhalikar und ihr Team anlysierten dann die Daten und werteten dann aus, wie stark die Verbindungen zwischen 95 Bereichen des Hirns waren. Sie fanden Unterschiede zwischen diesen Netzwerken, abhängig vom Geschlecht der Versuchspersonen. So sei bei Männern die Vernetzung innerhalb der Hirnhälften stärker ausgeprägt; dafür seien bei Frauen linke und rechte Hirnhälfte besser miteinander verdrahtet.
Uns fehlt es am Vorwissen, um die Studie selbst im Detail unter die Lupe zu nehmen. Deshalb haben wir hier einige offene Fragen zu dieser Arbeit zusammengetragen:
- Niemand bestreitet, dass es biologische Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt, etwa was Hirngröße und Hormonspiegel angeht. Bekannt ist jedoch auch, dass Männer und Frauen in vielen Lebensbereichen von ihrer Geburt an unterschiedlich behandelt werden. Es wäre verwunderlich, wenn sich das nicht auch in neurologischen Unterschieden ausdrücken würde. Ingalhalikar und Kollegen können aber nicht sagen, welche Ursachen die gefunden Differenzen zwischen Mann und Frau haben (mehr dazu: Tom Stafford/Are men better wired to read maps or is it a tired cliché?).
- Die Forscher aus Philadelphia haben zwar statistisch signifikante Unterschiede gefunden. Diese waren allerdings ziemlich gering. Möglicherweise sind sie für den Alltag deshalb bedeutungslos (mehr dazu: Christian Jarrett/Getting in a Tangle Over Men’s and Women’s Brain Wiring).
- Dazu passt: Eine frühere Studie des Forschungsteams um Ingahalikar fand nur sehr geringe psychologisch relevante Geschlechtsunterschiede. Dabei ging es um Fähigkeiten wie Aufmerksamkeitskontrolle, Gedächtnis, logisches Denken, räumliche Verarbeitung, sensomotorische Fähigkeiten und soziales Denken. Um Dinge wie einparken und einfühlen ging es übrigens auch in dieser Arbeit nicht (mehr dazu: Cordelia Fine/New insights into gendered brain wiring, or a perfect case study in neurosexism?).
- Alternativhypothesen werden zu wenig berücksichtigt. So könnte es theoretisch sein, dass die gefundenen Unterschiede weniger mit dem Geschlecht der Versuchspersonen zu tun hatten als mit ihrer Hirngröße. Denn größere Hirne sind in der Regel anders verdrahtet als kleine. Es ist es möglich, dass die Befunde letztlich nur etwas über Unterschiede zwischen Menschen mit großen und kleinen Hirnen sagen; das Geschlecht wäre dann nicht die Ursache dieser Differenzen (mehr dazu: Cordelia Fine/New insights into gendered brain wiring, or a perfect case study in neurosexism?).
- Nicht berücksichtigt wurden mögliche Messfehler durch Kopfbewegungen. Vielleicht unterscheiden sich Männer und Frauen auch dadurch, dass eine Gruppe den Kopf häufiger während eines Hirnscans bewegt als die andere (mehr dazu: Neuroskeptic/Men, Women, and Big PNAS Papers).
Quelle: Madhura Ingalhalikar et al (2013). Sex differences in the structural connectome of the human brain. PNAS, online vor Print, 2. December 2013. DOI: 10.1073/pnas.1316909110 (Abstract)