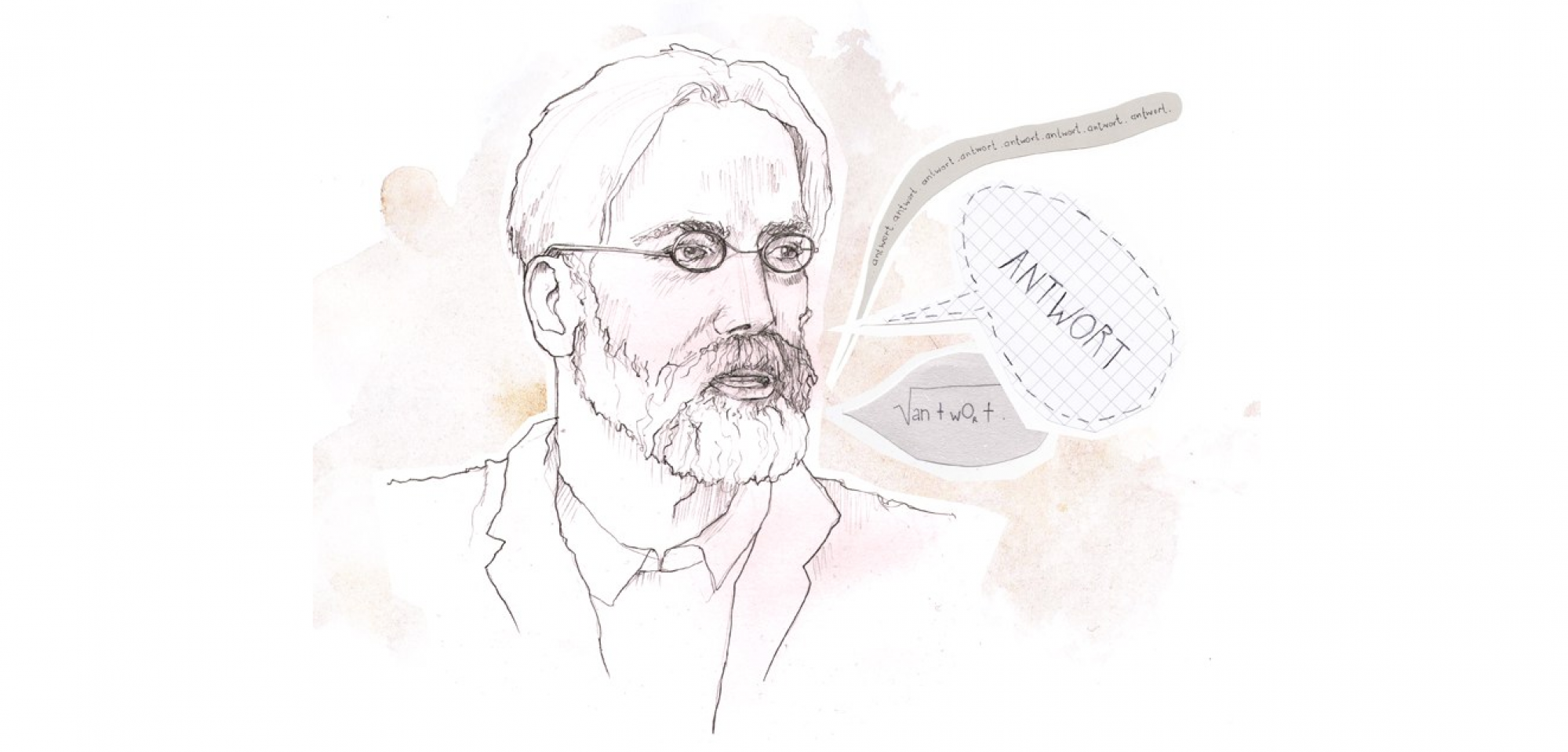StimmtHaltNicht – Sehr wahrscheinlich gibt es den Mozart-Effekt nicht. Klassische Musik hat wohl keine direkte Auswirkung auf die Intelligenz.
Wir dachten: Das ist bekannt. Zwar hatte 1993 die Neurologin Frances Rauscher berichtet, dass die Musik des österreichischen Komponisten die geistige Leistung fördere. Doch in den folgenden 20 Jahren haben andere Wissenschaftler diesen Mythos eigentlich pulverisiert.
Doch im Dezember 2013 berichtet Spiegel Online: „[…] [Seit 1993] werden die klassischen Klänge als geradezu magisches Mittel zur Steigerung des IQ gefeiert. Eine neue Analyse zeigt nun: alles Unsinn.“
Neu ist daran wirklich wenig. Wissenschaftler um Kenneth Steele wiederholten noch im vergangenen Jahrtausend die Versuche von Rauscher. Ohne Erfolg: Obwohl sie ihren Probanden dieselben Mozartsonaten vorspielten und ihnen dieselben Aufgaben stellten, schnitten sie bei Intelligenztests nicht besser ab als andere Versuchspersonen.
Und 2010 veröffentlichten österreichische Psychologen um Jakob Pietschnig eine umfangreiche Metaanalyse, für die die Forscher knapp 40 einzelne Studien mit mehr als 3000 Teilnehmern ausgewertet hatten. Auch sie fanden nur äußerst geringe Auswirkungen klassischer Musik – die größten übrigens in den Studien, an denen Frances Rauscher selbst beteiligt war.
Bei Spiegel Online erfährt der Leser wenig von der langen, kritisch beäugten Geschichte des Mozart-Effekts. Mehr noch: Die Studie, die jetzt den Mythos zerstören soll, tut gerade das nicht. Denn Frances Rauscher spielte Studenten klassische Musik vor und ließ sie dann Intelligenztests zum räumlichen Denken lösen. Für die neue, auf Spiegel Online zitierte Arbeit beobachteten Forscher um Samuel Mehr dagegen vierjährige Kinder. Diese hörten keine Mozartsonaten, sondern wurden von ihren Eltern für sechs Wochen zur musikalischen Früherziehung geschickt. Und am Ende stand auch kein Intelligenztest, sondern es ging um andere Aufgaben, unter anderem zur räumlichen Orientierung.
Zusammengefasst: Spiegel Online beerdigt den Mozart-Effekt, obwohl der schon mehr als tot ist. Und gerade die vorgestellte Studie widerlegt ihn nicht. Warum er überhaupt herangezogen wurde, ist uns nicht klar. Schließlich wäre die Studie von Samuel Mehr auch sonst interessant gewesen.
Quellen:
Spiegel Online (2013). Mythos entzaubert: Musik von Mozart macht doch nicht klüger (Link)
Kenneth M. Steele et al. (1999). Prelude or requiem for the ‘Mozart effect’? Nature 400, 827. DOI: 10.1038/23611 (Volltext)
Jakob Pietschnig et al. (2010). Mozart effect–Shmozart effect: A meta-analysis. Intelligence, 38/3, 314-323. DOI: 10.1016/j.intell.2010.03.001 (Abstract)
Samuel A. Mehr (2013). Two Randomized Trials Provide No Consistent Evidence for Nonmusical Cognitive Benefits of Brief Preschool Music Enrichment. Plos One. DOI: 10.1371/journal.pone.0082007 (Volltext)